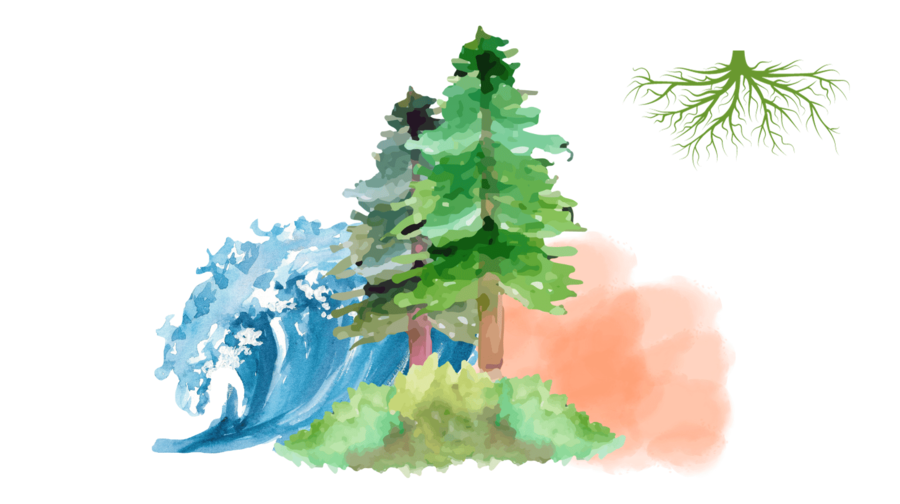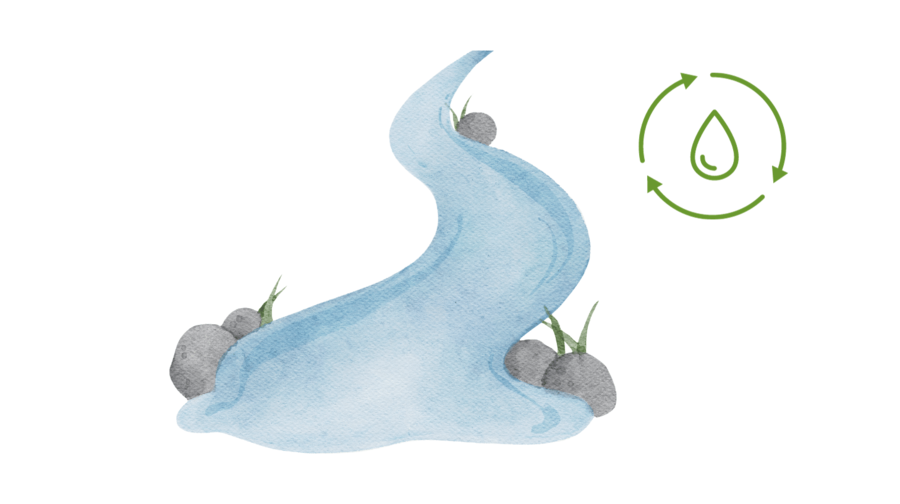Das erste Anzeichen der Krankheit sind unregelmässige Farbveränderungen der Blätter. Foto: H. Lenz/Waldwissen.net
Zeitschriften – Lesezeit 4 min.
«Es tut uns weh, die stattlichen Bäume fällen zu müssen»
15 Jahre schon wütet das Eschentriebsterben in unseren Wäldern. Der aus Asien eingeschleppte Pilz stellt Förster wie Werner Stocker aus Baar vor grosse Herausforderungen. Trotzdem gibt es auf dem Markt kein Überangebot an Eschenholz, die Preise bleiben stabil.
Sabine Vontobel* | Die Bilder sind zuweilen erschreckend. In vielen Regionen müssen hochgewachsene Eschen aus Sicherheitsgründen gefällt werden. So geschah es etwa diesen Frühling an einer vielbefahrenen Kantonsstrasse in Bremgarten (AG), wo rund 17 Bäume der Säge zum Opfer fielen. Was von aussen wirken mag wie ein brutaler Kahlschlag, hat seine triftigen Gründe. Die Eschen sind krank, befallen von einem in den 1990er-Jahren aus Ostasien nach Europa eingeschleppten Pilz. Befinden sich die stark befallenen Bäume in der Nähe von Strassen, Waldwanderwegen oder wichtiger Infrastruktur, müssen sie weg. Damit wird seit rund 15 Jahren zum Teil nicht unerheblich in den Schweizer Wald eingegriffen. Und dies wird vermutlich
so bleiben.
«Wir haben bereits 2010 mit der Reduktion der Eschen begonnen», bestätigt Christoph Schmid, Leiter des Forstbetriebs Mutschellen im Kanton Aargau. «Unser Betrieb wies 2004 noch einen Eschenanteil von 28 Prozent aus. In der aktuellen Planung haben wir gerade noch 7%. Wir sind mit diesen hohen Zahlen sicher ein Spezialfall und kaum exemplarisch fürs Mittelland.» Die Situation habe sich in seinem Betrieb in den letzten Jahren sogar noch verschlimmert. Früher seien die Eschen von der Krone her abgedorrt. Heute seien sie stark am Stammfuss befallen, und man könne ihrem Sterben richtiggehend zusehen. «Wir müssen vermehrt auch Privatwälder angehen, weil durch umfallende oder hängende Bäume sowie durch herabfallende Äste ein erhebliches Sicherheitsrisiko für Passanten besteht», so Schmid weiter. Lange Zeit sei es schwierig gewesen, die Besitzer von Privatwäldern von der Wichtigkeit dieser Eingriffe zu überzeugen, weil die Bäume von blossem Auge relativ gesund aussahen. «Seit die Eschen allerdings von allein umfallen, ist die Überzeugungsarbeit weniger aufwendig», sagt Schmid.
Das Verständnis eines Teils der Bevölkerung ist laut Christoph Schmid aber nach wie vor gering – wohl auch aus Mangel an gezielter Information. «Die Leute greifen uns auf verschiedenste Art und Weise an, weil wir oft ganze Waldpartien entfernen müssen.» Nicht zu unterschätzen sei auch die emotionale Ebene. «Bestände, die wir jahrelang gehegt und gepflegt haben, fallen aus. Es tut auch uns Forstleuten weh, dem zusehen zu müssen. Wir sind machtlos, und es ist ganz und gar nicht motivierend, so zu arbeiten», erklärt der Förster. Hinzu kommt, dass die kranken Bäume auch ein Sicherheitsrisiko für die Waldarbeiterinnen und Waldarbeiter darstellen. «Es gibt zum Beispiel Hänger oder Dürrholz. Beides ist sehr gefährlich und kann von Lernenden nicht mehr bearbeitet werden. Oft können wir die Bäume auch nicht mehr dorthin fällen, wo wir das wollen, weil sie zu früh abbrechen.»
Im Kanton Aargau wird heute bei der Durchforstung auf andere Baumarten gesetzt. In jüngeren Beständen werden die Eschen stehen gelassen, in der Hoffnung, dass möglicherweise einzelne Bäume die Pilzattacke schadlos überstehen. «Im gesamten Aargauer Wald ist der Eschenanteil mit 4 % eher gering», sagt Schmid. Schade sei jedoch, dass in fichtenreichen Wäldern versucht wurde, für eine optimale Durchmischung mit Esche, Buche oder Ahorn Laubholz einzubauen. Jetzt falle die Esche weg, was – speziell auf nassen Böden – zu einer Verarmung der Baumarten führe.
Die Auswirkungen der Eschenkrankheit auf den Holzerlös im Kanton Aargau seien wohl eher gering, so Schmid. «Bisher können die Eschen noch gut als Sägereiholz verkauft werden. In den nächsten Jahren erwarten wir trotzdem eine höhere Mortalität, also Holz, das gar nicht mehr genutzt werden kann.» Im Betrieb von Christoph Schmid gab es Jahre, in denen bis zu 100 % Schadholz aus Zwangsnutzung angefallen sind. Im ganzen Kantonsgebiet belaufe sich die Zwangsnutzung in den letzten Jahren derweil auf etwa 50 %. Darin sind allerdings nicht nur Eschen enthalten. «Beim Anzeichnen der Bäume berücksichtigen die Förster vermutlich immer eine andere Baumart und entfernen vorweg die Esche. Ob dies jedoch stets als Zwangsnutzung deklariert wird, bleibt fraglich.»
Jährliche Zwangsnutzung gestiegen
Vom Eschentriebsterben sind so ziemlich alle Kantone des Mittellands betroffen. Dazu gehört auch der Kanton Zug, wo es vor allem in den Talgebieten relativ grosse Eschenbestände gibt. «Die Esche ist bei uns die häufigste Laubholzart. Sie macht auf dem Papier etwa 7 bis 8 % des Waldes aus», erklärt Walter W. Andermatt, ehemaliger Präsident von WaldZug sowie Präsident der Korporation Baar-Dorf. Effektiv habe sich der Bestand seit 2016 aber wahrscheinlich halbiert. Eine detaillierte Waldaufnahme, die derzeit in Arbeit ist, wird im Laufe der kommenden Monate ein konkreteres Bild zeichnen.
Im Prinzip sei der Standort Baar mit seinen frischen und feuchten Böden für die Esche ideal, sagt auch der zuständige Förster, Werner Stocker. Seit 2016 müsse nun wegen des Eschentriebsterbens stark in den Wald eingegriffen werden. «Die Zwangsnutzung ist erheblich, äusserst aufwendig, und es tut uns selbst weh, die oft stattlichen Bäume fällen zu müssen», betonen Stocker und Andermatt unisono. Seit 2016 hat die jährliche Zwangsnutzung im Kanton Zug kontinuierlich von 2700 Kubikmeter auf rund 4000 Kubikmeter im letzten Jahr zugenommen.
In jedem Fall sei das Schlagen der kranken Bäume nötig, da die Sicherheit von Erholungssuchenden im Wald gefährdet ist. «Wir haben viel Erholungswald, der mit Wegen und Strassen gut erschlossen ist. Das heisst aber auch, dass sich zahlreiche Spaziergänger, Jogger, Pilzsucher oder Automobilisten und Velofahrer im und um den Wald aufhalten. Dass ihnen nichts passiert, hat natürlich Priorität», betont Andermatt. Auch in Baar seien die Reaktionen der Passanten auf die Baumschläge zuweilen negativ. «Wir versuchen über verschiedene Kanäle, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Hierfür arbeiten wir eng mit der Gemeinde zusammen, organisieren Zusammenkünfte und Waldbegehungen oder informieren über die Medien», so Walter W. Andermatt.
Krankheit diktiert Waldpflege
Bisher könne das Eschenholz trotz Pilzbefall noch gut als Sägerei- und Energieholz verwertet werden, pflichtet Werner Stocker seinem Kollegen aus dem Aargau bei. Abnehmer seien genügend vorhanden. Von einem Überangebot und einem damit einhergehenden Preiszerfall sei derzeit jedenfalls nichts zu spüren. Man wende grundsätzlich dieselbe Strategie an wie beim Borkenkäferbefall. «Wir holen die Bäume früh genug heraus, damit das Holz noch nutzbar ist.» Aus rein wirtschaftlichen Überlegungen sei besagtes Prozedere nicht ideal, da der Aufwand der einzelnen Fällungen im Erholungswald kaum mit dem Ertrag zu decken sei. Zudem werde die Waldpflege sozusagen von der Krankheit diktiert. «Momentan machen die forcierten Holzschläge etwa einen Viertel der Gesamtzahl aus», so Stocker. In diesem Jahr habe sich die Situation – wohl aufgrund des Klimas und der Zunahme von Schädlingen – noch verschlimmert. Trotzdem stirbt die Hoffnung zuletzt: «Obschon es kein effizientes Mittel gegen das Eschentriebsterben gibt, sehen wir immer wieder Bäume, die resistent sind. Vielleicht findet die Natur ihren Weg, und die resistenten Bäume produzieren Nachwuchsbäume, denen es am Ende gelingt, den Bestand zu retten», so Walter W. Andermatt.
Keine Schwemme von Eschenholz auslösen
Die Aussagen der Forstverantwortlichen decken sich mit den Beobachtungen der Holzmarkt-Experten. Trotz des Eschensterbens sind die Preise nicht unter Druck. «Der Anteil an Eschen auf dem Markt ist relativ gross und bewegt sich bei einem Anteil von rund 30 Prozent des Laubholzes», sagt Heinz Engler von Holzmarkt Ostschweiz. Dies werde voraussichtlich auch in den nächsten Jahren so bleiben. Man könne jedoch nicht von einem Überangebot sprechen. «Es ist eher so, dass unsere Kunden gerne noch mehr Esche hätten. Die hohe Nachfrage und der Gedanke, dass es diese Baumart bald nicht mehr geben könnte, treiben die Preise seit ein paar Jahren sogar eher leicht in die Höhe.» Bei der Esche handelt es sich um eine Baumart, die sehr gut zu bearbeiten und lange lagerfähig ist. Aus Esche werden laut Engler etwa Stiele für Werkzeuge, Möbel, Parkett oder Lamellen für verleimte Träger hergestellt. Die Produkte bewegen sich zwischen 100 und 350 Franken pro Festmeter. Brennholz wird zu etwa 60 bis 70 Franken pro Festmeter verkauft. Die Schweiz brauche zwar viel Esche für höherwertige Produkte, das meiste Holz gehe allerdings nach Italien.
Engler würde den Försterinnen und Förstern keinesfalls raten, die Eschen jetzt möglichst schnell auf den Markt zu bringen. «Es sollen wirklich nur jene Bäume gefällt werden, die vom Eschentriebsterben stark betroffen sind und mit Blick auf die Sicherheit entfernt werden müssen. Auf diese Weise kommt immer etwas Esche auf den Markt, und es kommt zu keiner Überflutung.»
Didier Wuarchoz, Direktor der Genossenschaft für Waldbesitzer und -betreiber La Forestière im Waadtland, sieht das ähnlich. «Es macht überhaupt keinen Sinn, nun vermehrt Eschen auf den Markt zu spülen. Es sollten wirklich nur die kranken Bäume genommen werden, also jene, die bei starken Windböen fast von allein umfallen würden.» Auch er beobachtet keine frappanten Preisschwankungen oder eine anormale Zunahme des Verkaufs von Eschenholz. «Laubhölzer mit grossem Umfang lassen sich allgemein besser verkaufen. Die Preise von Eschenholz liegen grob zwischen 120 und 200 Franken pro Kubikmeter. Das Holz wird aufgrund seiner gräulichen Farbe gerne für Parkettböden verwendet und zu einem Grossteil ins Ausland exportiert.» Es erstaune ihn selbst, so Wuarchoz, dass die Krankheit bisher kaum signifikant negative Auswirkungen auf den Preis zeige. «Eigentlich ist die Preistendenz von Esche in diesem Jahr eher gleichbleibend, wie bei den meisten anderen Laubhölzern auch», sagt er.
Den Eschen noch eine Chance geben
Die Baumkrankheit hat im Gegensatz zum Preis offensichtliche Auswirkungen auf den Wald. Die Forstverantwortlichen müssen Ersatzbaumarten finden, kranke Bäume schweren Herzens schlagen und um den Fortbestand der Art bangen. Auch Forschende nehmen sich des Themas seit Jahren an. Zu ihnen gehört Valentin Queloz von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL). Er glättet die Wogen und sagt: «Die Esche hat noch eine Chance. Wir treffen im Wald immer wieder scheinbar resistente Eschen an. Und mehr als 50 Prozent dieser schönen Bäume erweisen sich auch im Labor als resistent.» Dies übrigens nicht nur gegenüber dem Eschentriebsterben. Erste Versuche würden gewisse Kreuzresistenzen gegenüber dem Eschentriebsterben und dem Eschenprachtkäfer zeigen. An der WSL versuchen Forscherinnen und Forscher, resistente Eschen zu züchten. Eine gezielte Aufforstung von geeigneten resistenten Eschen könnte also das Fortschreiten beider invasiver Arten gleichzeitig ausbremsen.
Gemäss Queloz findet derzeit kein flächendeckender Waldumbau statt. Die teilweise schweren Eingriffe scheinen höchstens punktuell zu sein und vereinzelte Gebiete zu betreffen. «Die Esche bildet selten allein Bestände und ist oft mit anderen Laubbaumarten gemischt. An solchen Standorten ist der Verlust von einzelnen Bäumen in der Regel unproblematisch.» Schwierigkeiten gebe es allerdings an den typischen feuchten Eschen-Ulmen-Standorten. «Dort haben wir in der Tat nicht viele Optionen für eine Verjüngung. Auch können diese freien Waldstandorte rasch durch Neophyten invadiert werden», weiss Queloz.
Am stärksten von der Krankheit betroffen sind naturgemäss Kantone oder Regionen mit den grössten Eschenvorräten (der Jura oder das Mittelland). «Je dichter die Eschen stehen, desto grösser sind die Schäden. Gleichzeitig sind hohe Temperaturen und trockene Verhältnisse für den Pilz nicht optimal.» Im Tessin oder Wallis seien deshalb momentan weniger Schäden zu beobachten. «In diesen Gebieten ist der Pilz aber auch erst später angekommen», relativiert Queloz. Resistente Bäume finden sich derweil überall. «Momentan kann man nicht sagen, dass eine Provenienz besser wäre als eine andere.»
Gefällt Ihnen dieser Beitrag? In der Zeitschrift "Wald und Holz" finden Sie den gesamten Artikel sowie zahlreiche weitere lesenswerte Artikel.
Wald und Holz jetzt abonnieren
ähnliche News aus dem Wald
Zeitschriften | Verband & Politik – Lesezeit 2 min
Die Aprilausgabe Wald und Holz ist da!
Eine Frage beschäftigt aktuell viele, wenn nicht alle Branchen: Woher kriegen wir unsere Fachkräfte? Das sieht auch in der Forstbranche nicht anders aus. Allerdings müsste hier die Frage vielleicht eher lauten: Wohin gehen unsere Fachkräfte? Und warum? M...
Zeitschriften | Verband & Politik – Lesezeit 2 min
«Ein Koch ohne Motorsäge ist kein richtiger Koch»
Der Gourmetkoch Stefan Wiesner, auch bekannt als der Hexer aus dem Entlebuch, verkochte schon Bäume von A bis Z. Er bereitet die Gerichte seiner alchemistischen Naturküche ausschliesslich über Holz und Kohle zu. Pro Jahr benötigt er dafür rund 100 Ster...
Zeitschriften | Verband & Politik – Lesezeit 2 min
«Gesunde Stadtbäume benötigen eine unterirdische Raumplanung»
Andrea Gion Saluz von Grün Stadt Zürich ist für gesunde Stadtbäume und einen zunehmenden Bestand verantwortlich. Eine Herausforderung zu Zeiten der Verdichtung und der Klimaerwärmung, welche den Stadtbäumen besonders zusetzt.
Zeitschriften | Verband & Politik – Lesezeit 2 min
Aus der Mitte der kanadischen Wäldern: Wo der Ahornsirup fliesst
Die kanadische Provinz Québec deckt über 70% der weltweiten Ahornsirupproduktion ab; mit jährlichen Exporten von über 90 Millionen Litern. Riesige natürliche Ahornwälder, ein kalter Winter und ein langer Frühling bieten die besten Voraussetzungen für de...
Zeitschriften | Verband & Politik – Lesezeit 2 min
Bund darf sich nicht aus der Verantwortung nehmen
Der Schweizer Wald steht unter Anpassungsdruck – dies ist das Fazit des Waldbe-richts 2025, den das Bundesamt für Umwelt (BAFU) am 18. März 2025 präsentiert hat. Aus Sicht der Waldeigentümerinnen und -eigentümer ist eine Anpassung des Waldes an den Kl...
Zeitschriften | Verband & Politik – Lesezeit 2 min
Wald: Wichtiges Ökosystem für die Ernährungssicherheit
Der Internationale Tag des Waldes findet jeweils am 21. März statt. Unter dem Motto «Wälder und Nahrung» macht er heuer auf den Stellenwert gesunder Wälder für die Lebensmittelversorgung aufmerksam.
Zeitschriften | Verband & Politik – Lesezeit 2 min
Waldflächen in Uri werden mit klimafitten Baumarten bepflanzt
Im Kanton Uri werden in den kommenden Jahren 15 000 junge Bäume gepflanzt. Damit soll der Wald einerseits klimafit gemacht werden. Andererseits hat das Projekt zum Ziel, die wichtige Schutzfunktion der Wälder im Gebirgskanton zu stärken.
Zeitschriften | Verband & Politik – Lesezeit 2 min
Die Märzausgabe Wald und Holz ist da!
Das Klima auf unserem Planeten verändert sich schneller denn je. Obwohl sich die Natur eigentlich recht gut selbst zu helfen weiss, gerät sie ob dieses rasanten Wandels arg unter Druck. Der Wald beispielsweise kann mit diesem Wandel nicht mehr Schritt halt...
Zeitschriften | Verband & Politik – Lesezeit 2 min
Kleine Ski-Manufakturen gehen zurück zum Werkstoff Holz
Back to the roots. Zwei Schweizer Skiproduzenten setzen bei ihren Wintersportgeräten vermehrt auf Holz. Nicht nur auf dem Deckblatt, sondern auch im Kern verwenden sie den nachhaltigen Rohstoff, und einer davon recycelt diesen sogar.
Zeitschriften | Verband & Politik – Lesezeit 2 min
Die neue Ausgabe Wald und Holz ist da!
In den Schweizer Wäldern wächst ein patenter Stoff, dessen Einsatzmöglichkeiten schier unbegrenzt sind. Und das im wahrsten Sinn des Wortes! Seit Anfang Dezember kurvt sogar ein japanischer Satellit mit einer Verkleidung aus Magnolienholz im Orbit. Ho...
Zeitschriften | Verband & Politik – Lesezeit 2 min
Wenn die Ansprüche von Wald und Siedlung aufeinandertreffen
Aufgrund der zunehmenden Bautätigkeit rücken Häuser näher an den Wald. Die gesetzlich vorgegebenen Abstände werden immer häufiger unterschritten. Felix Holenstein, Revierförster von Dietikon (ZH), hat in solchen Fällen eine Lösung für Waldbesitzende...
Zeitschriften | Verband & Politik – Lesezeit 2 min
Alte Bäume neu entdeckt: Kastanienselven im Puschlav
Im Puschlav (GR) haben sich die Menschen wieder auf die traditionellen Kastanienselven, welche während langer Zeit vernachlässigt worden sind, zurückbesonnen. Ihre Wiederherstellung ist aufwendig. Ein Rundgang mit einem Besitzer einer Selve.
Zeitschriften | Verband & Politik – Lesezeit 2 min
Die neue Ausgabe Wald und Holz ist da!
In den Schweizer Wäldern wächst ein patenter Stoff, dessen Einsatzmöglichkeiten schier unbegrenzt sind. Und das im wahrsten Sinn des Wortes! Seit Anfang Dezember kurvt sogar ein japanischer Satellit mit einer Verkleidung aus Magnolienholz im Orbit. Ho...
Zeitschriften | Verband & Politik – Lesezeit 2 min
Die Biker sind hier – ihnen Trails zu verbieten, funktioniert nicht
Mountainbikerinnen und Mountainbiker im Wald bewegen die Gemüter. Illegale Trails fordern Waldbewirtschaftende sowie -besitzende. Lösungsansätze im Umgang mit dieser Thematik lieferte das Forum der Arbeitsgemeinschaft für den Wald Ende Oktober.
Zeitschriften | Verband & Politik – Lesezeit 2 min
Asiatische Hornisse auch im Wald: So verhindert man ihr Ausbreiten
Die Asiatische Hornisse verbreitet sich rasant in der Schweiz. Da sich der Neozon von heimischen Honigbienen und anderen Insekten ernährt, ist es wichtig, dass man ihn frühzeitig erkennt und meldet. Im Winter sind die Nester in den Baumkronen leichter zu en...
Zeitschriften | Verband & Politik – Lesezeit 2 min
«Es ist wunderbar, zuzusehen, wie viele Knöpfe im Wald aufgehen»
Die Natur und der Wald hätten sie als Kind inspiriert, sagt Berna Weber aus Arth (SZ), weshalb sie tief mit ihnen verwurzelt sei. Es ist also naheliegend, dass Natur und Wald in ihren Kinderbüchern die Kulisse für die Erlebnisse ihrer Protagonisten bi...
Zeitschriften | Verband & Politik – Lesezeit 2 min
Die kalte Jahreszeit hilft Bäumen beim Wachsen und Gedeihen
In hiesigen Breitengraden treten Wald- und Obstbäume im Herbst in den «Winterschlaf», um der Kälte zu entkommen. Paradoxerweise brauchen sie aber genau diese Kälte, um im Frühling wieder aus der Ruhephase aufzuwachen. Zu milde Winter können Folgen habe...
Zeitschriften | Verband & Politik – Lesezeit 2 min
14-Millionen-Projekt «Werkraum Holz & Energie» wird zur Realität
In Wattwil baut der St. Galler Kantonalverband von Holzbau Schweiz ein neues Kurszentrum, dem ein «Forum für Innovation & Nachhaltigkeit» angegliedert werden soll. Für die Übernahme und den Betrieb des Forums wurde eigens eine Genossenschaft gegründet.
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Kalendertürchen 24 – Raum für Bildung und Forschung
Der Wald ist ein lebendiges Lehrbuch. Hier lernen wir viel über Artenvielfalt, Ökologie und die essenzielle Rolle des Waldes im Klimaschutz. Der Wald bietet Raum für wissenschaftliche Forschung, von der Untersuchung der Waldgesundheit bis hin zu nachhalt...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Kalendertürchen 23 – Raum für Kunst und Kultur
Der Wald inspiriert seit jeher Künstlerinnen und Künstler und ist Bühne für vielfältige kulturelle Ausdrucksformen. Ob als Motiv in der bildenden Kunst, als Schauplatz für Theateraufführungen oder als Rückzugsort für Autorinnen und Autoren sowie Musizier...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Kalendertürchen 22 – Raum für Spiritualität
Der Schweizer Wald ist nicht nur ein Ort der Erholung und Biodiversität, sondern auch ein Raum für Spiritualität, der viele Menschen mit seiner Ruhe und Beständigkeit inspiriert. Wer sich tiefer auf die Weisheit der Natur einlassen möchte, findet im...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Kalendertürchen 21 – Raum für Sport
Der Wald bietet nicht nur Erholung, sondern ist auch ein idealer Ort für sportliche Aktivitäten. Ob Trailrunning, Mountainbiken oder Yoga im Freien – die frische Waldluft und der natürliche Untergrund fördern Fitness, Konzentration und mentale Ausgeglichen...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Kalendertürchen 20 – Raum für Erlebnisse
Der Wald ist ein Ort, der uns Erlebnisse in ihrer ursprünglichsten Form schenkt – sei es beim Wandern, Beobachten von Tieren oder beim Lauschen der Naturklänge. Er inspiriert, beruhigt und fordert heraus, gibt uns Raum zum Durchatmen und lässt uns den...
Zeitschriften | Verband & Politik – Lesezeit 2 min
Parlament beschliesst zusätzliche Gelder für Schweizer Wälder
In der zu Ende gegangenen Wintersession haben sich die Eidgenössischen Räte ein-gehend mit dem Budget 2025 befasst. Aus Sicht der Waldeigentümerinnen und -eigentümer sind die vom Parlament beschlossenen 17.5 Millionen Franken Kredite für den Wald, welc...
Zeitschriften | Verband & Politik – Lesezeit 2 min
Von Lumpenbäumen, Nagelbäumen und heilenden Bäumen
In Frankreich gibt es einen seltsamen Brauch: Bäume, an denen Lumpen hängen, in denen Nägel stecken oder in denen Statuen stehen, sollen heilend wirken. Diese vermeintlich «hohen Orte» beruhen auf heidnischen Überlieferungen und Legenden aus der Heiligen...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Kalendertürchen 19 – Landschaftsbild und Erholung
Der Wald ist nicht nur ein Ort des Wirtschaftens, sondern auch ein Raum, der unser Landschaftsbild prägt und zur Erholung einlädt. Mit seinen abwechslungsreichen Formen und Farben, dem Zusammenspiel von Licht und Schatten und den unterschiedlichen Vege...
Zeitschriften | Verband & Politik – Lesezeit 2 min
Stürme – Namenhafte Naturkatastrophen
Joanna Wierig | Ihre Namen sind unscheinbar – ihre immense Kraft hingegen mäht ganze Wälder nieder, zerstört Haus und Hof und kostet Tier- und Menschenleben. Immer wieder halten Orkane die Schweiz und den Verband in Atem. Der Stärkste erreichte eine...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Kalendertürchen 18 – Arbeitsplatz
Der Wald ist nicht nur ein natürlicher Lebensraum, sondern auch ein Arbeitsplatz, der vielfältige Berufe vereint. Försterinnen und Förster pflegen und schützen den Wald, um ihn für kommende Generationen zu bewahren. Forstingenieurinnen planen die Waldnu...
Zeitschriften | Verband & Politik – Lesezeit 2 min
Instrumente aus Schweizer Mondholz: Musiker schwören darauf
Sie erzeugen einen wärmeren Ton, einen besseren Klang und halten Jahrzehnte lang. Instrumente, die mit europäischem Fichtenholz hergestellt werden, das in der kalten Jahreszeit in der richtigen Mondphase geschlagen wird, sind auf der ganzen Welt gefragt.
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Kalendertürchen 17 – Erosions- und Hochwasserschutz
Der Wald schützt uns vor Naturgefahren, die mit Starkregen und Erosion verbunden sind. Wurzeln stabilisieren den Boden und verhindern, dass er durch Wasser abgeschwemmt wird, wodurch Hochwasser, Rutschungen und Bodenerosion deutlich reduziert werden. Besond...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Kalendertürchen 16 – Schutzwald
Schutzwälder sind unverzichtbar für den Erhalt unserer Landschaft und den Schutz vor Naturgefahren. Sie sichern nicht nur den Boden, sondern bieten auch Lebensraum für zahlreiche Pflanzen und Tiere. Diese Wälder bewahren uns vor Erosion, Lawinen und...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Kalendertürchen 15 – Waldreservat
Die Schweizer Waldreservate bieten eine einzigartige Möglichkeit, die Natur in ihrer ursprünglichen Form zu erleben und die Vielfalt des Lebens in den Wäldern zu entdecken. Diese Schutzgebiete sind nicht nur ein Rückzugsort für bedrohte Tierarten, sond...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Kalendertürchen 14 - Lebensraum Totholz
Der Schweizer Wald ist nicht nur ein Ort der Erholung, sondern auch ein Lebensraum, der durch sein Totholz eine besondere Bedeutung für das Ökosystem hat. Totholz bietet unzähligen Insekten und Kleinstlebewesen einen wichtigen Lebensraum und trägt so w...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Kalendertürchen 13 – Luftfilter
Unsere Wälder leisten wertvolle Arbeit, die uns oft erst bewusst wird, wenn wir tief durchatmen. Sie fangen Staub, Russpartikel und Schadstoffe aus der Luft auf und verbessern so die Luftqualität – ein natürlicher Filter, der uns hilft, sauberere Luft z...
Zeitschriften | Verband & Politik – Lesezeit 2 min
Die neue Ausgabe Wald und Holz ist da!
Jubel, Trubel, Weihnachtszeit! Während die einen von Weihnachtsmarkt zu Weihnachtsmarkt hetzen, sich dem Konsumterror unterwerfen und inmitten dieser besinnlichen Zeit ihre eigene Besinnung zu verlieren drohen, machen sich andere mitten in der Nacht...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Kalendertürchen 12 – Trinkwasserschutzgebiet
In der Schweiz kommen rund 80% des Trinkwassers direkt aus dem Grundwasser – und ein Grossteil davon wird durch die Wälder geschützt. Wälder filtern Schadstoffe und reichern das Wasser mit lebenswichtigen Mineralien an, bevor es in unsere Trinkwasserspeicher fl...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Kalendertürchen 11 – Kohlenstoffspeicher Waldboden
Der Waldboden speichert eine enorme Menge an Kohlenstoff, mehr noch als die Bäume selbst. Dieser unscheinbare Speicher ist ein wesentlicher Akteur im Klimaschutz, indem er CO₂ langfristig bindet und somit hilft, die Erderwärmung zu bremsen. Die schonende...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Kalendertürchen 10 – Kohlenstoffspeicher Biomasse
Wälder sind unverzichtbare Kohlenstoffspeicher: Sie nehmen CO₂ auf, binden es in ihrer Biomasse und helfen so, die Atmosphäre zu entlasten und den Klimawandel zu bremsen. Bäume wie die Arve (auch Zirbe genannt) wachsen in den Hochlagen der Alpen. Diese...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Kalendertürchen 9 – Klimaschutz
Wälder sind wahre Klimaschützer. Sie binden CO₂, regulieren das Wetter und tragen massgeblich zur Erhaltung der Biodiversität bei. Der Schutz und die Aufforstung von Wäldern sind daher wesentliche Schritte im Kampf gegen den Klimawandel. Jeder Baum,...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Kalendertürchen 8 – Kühlleistung
Der Wald wirkt nicht nur kühlend auf die Umwelt, sondern bietet auch eine erfrischende Quelle für neues Wissen. Wenn man sich in den Wald begibt, entdeckt man unzählige Geheimnisse – von winzigen Tieren bis hin zu den uralten Bäumen. Für Kinder, die...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Kalendertürchen 7 – Genetische Ressourcen (Artenvielfalt)
Die Artenvielfalt im Wald ist ein kostbares Gut, das es zu schützen gilt. Besonders faszinierend sind Tiere wie Fledermäuse, die in der Schweiz eine wichtige Rolle im Ökosystem spielen. Es gibt hierzulande rund 30 Fledermausarten, die nicht nur als In...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Kalendertürchen 6 – Trinkwasser
Wald und Wasser – zwei essentielle Elemente, die eng miteinander verbunden sind. Der Wald spielt eine zentrale Rolle bei der Aufbereitung und dem Schutz unseres Trinkwassers. Er filtert, speichert und gibt es wieder ab, sodass wir immer auf sauberes, frisches...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Kalendertürchen 5 – Wildfleisch
Bei Waldleistungen, die der Schweizer Wald der Bevölkerung erbringt, geht es nicht nur um Bäume und Pflanzen, sondern auch um eine wertvolle Ressource: Wildfleisch. Rehe, Hirsche und Gämsen bieten uns nicht nur ein Stück Natur, sondern auch einen gesund...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Kalendertürchen 4 – Pilze, Beeren und Kräuter
Jeder Wald hat einen Eigentümer oder eine Eigentümerin. In der Schweiz gilt aber das freie Betretungsrecht, weshalb wir den Wald betreten und geniessen dürfen – sei es zum Wandern oder zum Sammeln von Pilzen, Beeren und Kräutern in haushaltsüblichen...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Kalendertürchen 3 – Energieholznutzung
Der Wald liefert uns nicht nur Holz für den Bau und die Möbelindustrie, sondern auch eine wertvolle Energiequelle. Die Nutzung von Holz als Brennstoff ist eine nachhaltige Methode, um sowohl Heizenergie als auch gesunde, schmackhafte Mahlzeiten zu erze...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Kalendertürchen 2 – Stoffliche Holznutzung
Der Wald liefert nicht nur den Lebensraum für unzählige Tiere und Pflanzen, sondern auch das wertvolle Material Holz. Dieses vielseitige Naturprodukt wird in vielen Bereichen genutzt – vom Bau bis hin zur Herstellung von feinen Haushaltsgegenständen. Besonders die stoffli...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Kalendertürchen 1 – Sauerstoffproduktion
Der Schweizer Wald ist nicht nur ein Ruhepol und Erholungsraum für die Bevölkerung, sondern auch ein unverzichtbarer Bestandteil des Landes, der eine wichtige Rolle im Ökosystem spielt, indem er Sauerstoff produziert, Trinkwasser filtert, das Klima sc...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Es muss nicht immer eine Nordmanntanne sein
– aber aus der Schweiz sollte der Christbaum kommen. Schweizer Kundinnen und Kunden sind beim Kauf ihrer Christbäume eher traditionell unterwegs. Auf dem Markt haben sich drei Nadelbaumsorten besonders gut etabliert, obwohl es viele weitere, ebenfalls in der...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Die Oktoberausgabe Wald und Holz ist da!
In der neuen Ausgabe von «WALD und HOLZ» dreht sich alles um die Arbeitssicherheit. Die Gefahr ist im Forst eine ständige Begleiterin. Damit sie den Arbeiterinnen und Arbeitern im Wald aber nicht zu sehr auf die Pelle rückt, setzen sich tagtäglich viel...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Eine gut eingespielte Rettungskette ermöglicht effektive Hilfe
Um die Ausbildung ihrer Partner im Wald zu optimieren, hat die Rega zusammen mit dem Bereich Ausbildung von WaldSchweiz im Oktober 2023 ein drittes Schulungsvideo gedreht. Der Clip wird verwendet, um den Forstarbeitern zu zeigen, wie eine Rettungswinde im Wald...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Ist eine nachhaltige Waldwirtschaft auch in Afrika möglich?
Im Rahmen seiner Bachelorarbeit reiste der angehende Forstingenieur Oliver Reinhard in den Dschungel von Gabun. Mittels einer Vorstudie wollte der 25-Jährige herausfinden, ob es dort möglich ist, Holz nachhaltig zu ernten. Hier berichtet er von seinen Erf...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
«Alles steht und fällt mit der Sicherheitskultur in den Betrieben»
Urs Limacher ist Teamleiter Forst/Dienstleistungen bei der Suva. Der gelernte Förster spricht im Interview über sinkende, aber immer noch zu hohe Unfallzahlen, deren Ursachen und seinen Optimismus, warum die Arbeit im Wald immer sicherer werden wird.
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Monetäre Bewertung von Wildschäden im Schutzwald
An sechs Fallbeispielen im Kanton Graubünden zeigt ein interdisziplinäres Team, wie Wildverbissschäden finanziell beziffert werden können. Bei der Interpretation der Resultate müssen die spezifischen Voraussetzungen jedes Standortes sorgfältig berücksichti...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Parlament gibt grünes Licht für Preiseempfehlungen für Schweizer Holz
In der zu Ende gegangenen Herbstsession haben sich die Eidgenössischen Räte mit verschiedenen Geschäften befasst, welche den Wald betreffen. Ein Grosserfolg war die erfolgreiche Verabschiedung der Parlamentarischen Initiative Fässler, welche Preisempfehlunge...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Gehege um Pflanzeninseln als veritabler Quell der Biodiversität
Die Verjüngung von eingehagten Pflanzeninseln auf bewaldeten Weiden beflügelt die Biodiversität geradezu. Die ValForêt SA, die in den Kantonen Bern und Jura tätig ist, kümmert sich um mehrere Hundert solcher Gehege, und sie treibt auch deren Weiterentwicklun...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Verpflichtungskredit Umwelt
Der Nationalrat hat am 23. September 2024 entschieden, dass der Verpflichtungskredit Wald für die Jahre 2025 bis 2028 um 70 Millionen Franken aufgestockt wird. Dieser Entscheid fiel mit 125 zu 60 Stimmen bei 5 Enthaltungen überaus deutlich aus.
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Zur Abstimmung über die Biodiversitätsinitiative vom 22. September 2024
WaldSchweiz nimmt das Abstimmungsergebnis zur Biodiversitätsinitiative mit Zufriedenheit zur Kenntnis. 63 Prozent der Schweizer Stimmbevölkerung haben am 22. September 2024 Nein zur Biodiversitätsinitiative gesagt.
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Vom unterschätzten Wert der Fledermäuse für Waldökosysteme
Mit 30 gelisteten Arten machen die Fledermäuse fast einen Drittel aller bekannten und belegten Säugetiere (100 Arten) in der Schweiz aus. Der Einfluss der unscheinbaren Fledertiere auf die Vitalität des Waldes ist von entscheidender Bedeutung.
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Waldreservat-Gestaltung durch den Biber – eine Zukunftslösung?
Seit seiner Wiederansiedlung in der Schweiz vor 68 Jahren hat sich der Biber stark vermehrt. 4900 Tiere wurden im Jahr 2022 gezählt. Der Nager beeinflusst die Landschaft und die Biodiversität, verursacht aber auch Schäden. Eine für alle gute Lösung kö...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Parlament ermöglicht Richtpreise für Schweizer Holz
Waldbesitzer und Abnehmer von Rohholz können künftig Richtpreise vereinbaren und diese veröffentlichen. Nach dem Ständerat hat am Dienstag auch der Nationalrat einer entsprechenden Vorlage zugestimmt.
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Wilddruck verhindert Verjüngung von Weisstannen im Schutzwald
Wenig Erfolg trotz hohem Potenzial: Eine mehrjährige Studie zeigt, dass die natürliche Verjüngung der Weisstanne in den Schutzwäldern im Misox (GR) grundsätzlich möglich ist, dass aber starker Wildverbiss einen erfolgreichen Aufwuchs verhindert.
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Die Septemberausgabe Wald und Holz ist da!
Animalisch – So geht es in der neuen Ausgabe von «WALD und HOLZ» für einmal zu und her. Von Hirschen und Rehen über Biber und Fledermäuse bis zu Wildbienen ist alles dabei, was der Tierliebhaberinnen und -haber Herzen höherschlagen lässt. Jedoch, gemoch...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Er macht aus Schweizer Restholz nachhaltige Holzkohle
Der 24-jährige Forstwart Oliver Reinhard verarbeitet Holzreste einer nahen Sägerei in Waltalingen (ZH) zu hochwertiger Holzkohle. Nach dem Abschluss seines Bachelors in Waldwissenschaften an der Berner Fachhochschule will er voll darauf setzen.
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Im Klanghaus am Schwendisee gibt das regionale Holz den Ton an
Die Streichmusik mit Hackbrett, Violine, Cello und Bassgeige ist im Toggenburg weitverbreitet, und auch die Jodeltradition wird dort noch gelebt. Am Schwendisee entsteht zurzeit ein einmaliges musikalisches und architektonisches Zentrum für Naturmusik.
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Die Verjüngung von Wäldern fördert ihre Widerstandskraft
Lange Hitzeperioden, Jahrhundertstürme oder Trockenheit gefährden die Gesundheit der Wälder und stellen deren Resistenz auf eine harte Probe. Die Verjüngung ganzer Waldgebiete gehört vielerorts zu den wichtigsten Massnahmen im Hinblick auf den Klimawandel.
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Der Wald ist ohne Zweifel eines der grössten Potenzialthemen
Christoph Niederberger ist neuer Direktor von WaldSchweiz. Im Interview erzählt der diplomierte Forstingenieur ETH von seiner Motivation für diese Stelle, seinen Plänen mit dem Verband und warum es für ihn eben nicht eine «Rückkehr» in den Wald ist.
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Die neue Ausgabe ist da!
Obwohl man es bis Mitte Juli nicht wirklich nachvollziehen konnte, ist eine der verheerendsten Folgen des Klimawandels die Trockenheit. Sie setzt unsere Wälder grossem Stress aus, und sie zwingt Waldeigentümerinnen und -eigentümer, Massnahmen zu ergreife...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Insektenschutznetze zur Werterhaltung von Rundholz
Ein Folgeversuch zum Einsatz von Netzen statt Pflanzenschutzmitteln zum Schutz von im Wald gelagertem Rundholz liefert verheissungsvolle Ergebnisse. Noch sind die Kosten dafür zwar höher. Mit zunehmender Erfahrung und Verbreitung dürften diese künftig aber...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Orchester der Bodentiere sagt viel über Bodenbeschaffenheit aus
«Sounding Soil» macht mittels Bodensonden und Aufnahmegeräten auf Bodenlebewesen aufmerksam. Interessierte können sich die Geräte kostenlos ausleihen und so die Böden ganz neu entdecken. Je nach Baum und Standort tönt es im Waldboden unterschiedlich.
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Naturschutz ist keine Frage von Landesgrenzen
Urs von Burg aus der Schweiz und Tom Ekert aus Deutschland betreuen gemeinsam das Naturschutzgebiet Tannbüel im nördlichsten Zipfel der Schweiz. Über die Jahre hat sich zwischen den beiden Förstern ein intensiver Austausch über ihre waldbauliche Arbeit e...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Eichelhäher und Förster – zusammen für den Eichenwald
Der Verein proQuercus lanciert mit Unterstützung der Seedling Foundation ein Projekt zur Nutzung der unterstützten Hähersaat. Die Aktivität des Eichelhähers soll genutzt werden, um das Eichenvorkommen auf natürliche Weise zu erweitern.
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Ein Eichenwald für den Dachstuhl der Notre-Dame in Paris
Die Kathedrale Notre-Dame in Paris, Teil des Weltkulturerbes, erhebt sich aus ihrer Asche. Öffentliche und privat tätige Förster aus Frankreich haben zusammen über eintausend Eichen geliefert, die für den Dachstuhl auf dieser historischen Baustelle be...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Die Flatter-Ulme ist wohl die seltenste Baumart der Schweiz
Die Flatter-Ulme wird oft fälschlicherweise als eingeführte Art betrachtet und braucht einen neuen Status. Ein Forschungsprojekt der Universität Freiburg unter der Leitung des Biologen Yann Fragnière bestätigt, dass Ulmus laevis eine einheimische Wildba...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Waldfriedhöfe: neue potenzielle Einnahmequellen für den Forst
Ruhewald, Waldfriedhof oder Friedwald – die Namen sind unterschiedlich, das Prinzip dasselbe: Solche Ruhestätten befriedigen die Nachfrage weg vom Reihengrab hin zu anderen Bestattungsformen. Werden Zukunftsbäume zu letzten Ruhestätten, verhilft dies zu...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Wenn drei das Gleiche tun, ist das noch lange nicht dasselbe
Die Schweiz, Deutschland und Österreich verfügen über grosse Waldflächen mit zumeist den gleichen Baumarten. Die Forstwirtschaften funktionieren in den drei Staaten zwar ähnlich. Dennoch bestehen Unterschiede.
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Die Juni-Ausgabe ist da
Die Voraussetzungen für die Forstwirtschaft sind in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich weitgehend die gleichen. Dennoch unterscheiden sich die Forstwirtschaften in den drei Nachbarstaaten teilweise fundamental. In der neuen Ausgabe von «WALD...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Klimaveränderung fördert die Verbreitung der Misteln
Beobachtungen in der Schweiz und im nahen Ausland zeigen, dass sich der Halbschmarotzer ausbreitet. Besonders geschwächte Bäume sind betroffen. In einigen Regionen Deutschlands ist die Rede von einer Zunahme um 30 Prozent.
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Entwicklung stickstoffliebender Störungszeiger seit 2002
Die Entwicklung von Brombeeren, Holunder und Brennnesseln während der letzten 20 Jahre wurde schweizweit untersucht. Dabei wurde die Beziehung zwischen Stickstoffdeposition und Brombeerdeckung statistisch bestätigt und eine Zunahme der Störungszeiger festgestellt.
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Umgang mit invasiven Neophyten zur Erhaltung der Waldfunktionen
Ein neues Praxismerkblatt aus dem Kanton Tessin gibt konkrete Empfehlungen für die waldbaulichen Herausforderungen von morgen. Um die langfristigen Waldfunktionen zu erhalten, müssen invasive gebietsfremde Pflanzen bekämpft werden.
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
«Die Biodiversitätsinitiative hat für den Wald keinen Mehrwert»
Am 22. September 2024 kommt die Biodiversitätsinitiative zur Abstimmung. Daniel Fässler, Präsident von WaldSchweiz und Mitte-Ständerat für den Kanton Appenzell Innerrhoden, erklärt, warum WaldSchweiz die Initiative zur Ablehnung empfiehlt.
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Die neue Ausgabe ist da!
Der Wald muss zahlreiche Herausforderungen meistern, zum Beispiel die Veränderung des Klimas oder eine intensivierte Nutzung durch verschiedenste Anspruchsgruppen. Unter Druck steht der Wald aber auch an anderer Stelle: Invasive, gebietsfremde Arten...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Der schlaue Schwarzkittel tut dem Schweizer Wald richtig gut
Das Wildschwein hat seiner Ausrottung getrotzt und erobert seit Jahrzehnten die Wälder zurück. Die smarten Borstentiere bereiten der Forstwirtschaft dabei kaum Kopfzerbrechen, denn die positiven Einflüsse ihrer Anwesenheit auf den Wald überwiegen deutli...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Maschinendaten zur Optimierung der Holzernte nutzen
Die WSL entwickelt eine frei verfügbare Webapplikation, welche herstellerunabhängig das Analysieren und Weiterverarbeiten von Maschinendaten erlaubt. Künftig soll diese eine Ergänzung zu bestehenden Systemen darstellen und ein Benchmarking erlauben.
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Mykorrhizapilze: unerkanntes Potenzial für die Aufforstung
Gedeihen Bäume vital und kraftvoll, leben sie in Symbiose mit ihren Mykorrhizapilzen. In Schutz- und Bannwäldern, wo zuverlässiger Wuchs essenziell ist, können Wurzeln von Jungbäumen gezielt damit beimpft werden. Dieses Verfahren wird nun verfeinert.
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Die Suche nach zukunftsfähigen Baumarten in Europa
Die globalen Veränderungen gefährden die Waldleistungen. Um zukunftsfähige Baumarten zu finden, wurden in vielen europäischen Ländern Pflanzversuche angelegt. Die Schweiz beteiligt sich unter anderem mit dem Testpflanzungsnetzwerk.
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Wissen erhalten trotz Generationenwechsel im Forst
Die Babyboomer treten ab. Gemäss einer Umfrage wird bis 2030 etwa jeder zweite Revier- und Betriebsförster sowie jeder zweite Forstingenieur in Rente gehen. So bleibt das Wissen im Betrieb erhalten.
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Waldbauliche Erfahrungen aus Weiserflächen
Die Fachstelle für Gebirgswaldpflege hat im Sommer 2023 das BAFU-Projekt «Inwertsetzung der waldbaulichen Erfahrungen aus den NaiS-Weiserflächen» abgeschlossen. Hauptziele waren Fortschritte in der Umsetzung und Verankerung der Wirkungsanalyse in der Pr...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Natur und Kultur als Fundamente nachhaltiger Entwicklung
Die Geschichte bildet das Fundament für Kultur und Identität. Am Beispiel der Baumart Eiche wird deutlich, wie sich diese Begriffe auch heute in immateriellen Werten und konkreten Produkten spiegeln und die Grundlage für nachhaltige Entwicklung bilden.
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Die Sprache der Bäume: Was ist wahr, und was ist Humbug?
Können Bäume wirklich schmecken, riechen, fühlen und miteinander sprechen? Seit Jahren spukt diese Vorstellung durch die Öffentlichkeit – angefeuert durch populärwissenschaftliche Bücher und Filme. Doch wie weit ist die Forschung tatsächlich? Wir haben...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 3 min
«Es ist ein Privileg, im Refugium Wald arbeiten zu dürfen»
Der Architekt Pascal Tschopp liess sich in einer Drittausbildung zum Forstwart ausbilden. Die Lehre schloss er mit Bestnoten ab. Warum der damals 28-Jährige diese Entscheidung bis heute keine Sekunde lang bereut und trotzdem nicht mehr im Wald arbeitet.
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 3 min
Marketing hilft auch im Wald, um an neue Gelder zu kommen
Wie fördere ich das Verständnis für die Arbeit im Wald bei der Bevölkerung? Wie mache ich auf meine Produkte aufmerksam? Wie komme ich zu Mitarbeitern und genügend finanziellen Mitteln? Hier einige Taktiken aus dem Forst, um erfolgreich ans Ziel zu ko...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 3 min
Forêtxcellence setzt sich für aussergewöhnliche Hölzer ein
Der Jurabogen hat Potenzial für die Produktion von aussergewöhnlichen Hölzern, vor allem von Klangholz. Der Verein Forêtxcellence hat sich zum Ziel gesetzt, den Waldbesitzern einen grösseren Nutzen zu verschaffen. Der Verein nimmt seine Tätigkeit in...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 3 min
Mondholz: Eine alte Tradition entwickelt sich zum Trend
Holz, das in der kalten Jahreszeit in der richtigen Mondphase geschlagen wird, soll über herausragende Eigenschaften verfügen. Diesen wird man sich wieder vermehrt bewusst. Die Nachfrage danach steigt. Davon profitieren auch Forstbetriebe.
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 3 min
Der Tulpenbaum: eine Alternative für Schweizer Wälder?
Vor Millionen Jahren war die Gattung Liriodendron auch in Europa verbreitet. Doch obwohl der Tulpenbaum sich durch verschiedene positive Eigenschaften auszeichnet, nähert man sich ihm hierzulande nur vorsichtig an.
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 3 min
1923 regionale Fichten für neues Davoser Wahrzeichen
Zum 100. Geburtstag investiert der Spengler Cup für die Turnier-Hospitality in einen neuen Temporärbau namens Loftʼ23. Das Bauwerk im Kurpark, welches den bisherigen «EisDome» ersetzt, ist alles andere als gewöhnlich und vollständig aus regionalem Ho...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 3 min
Beim Energieholz übersteigt die Nachfrage das regionale Angebot
Die Zürcher Baudirektion hat festgestellt, dass die Nachfrage nach Energieholz bereits das regionale Angebot übersteigt. Zudem übersteigen die weiteren geplanten Anlagen das noch ausschöpfbare Potenzial.
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 3 min
Computergesteuert und auf vier Beinen autonom durch den Wald
Dieser Hund wird nie Stöckchen apportieren und auch keine Katzen jagen. In naher Zukunft aber dürfte er in Wäldern anzutreffen sein. Die ETH Zürich entwickelt zurzeit eine Anwendung, die für Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer interessant sein könnte.
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 3 min
Nach heftigen Stürmen: bessere Übersicht dank Drohnen
Das Institut für Photonics und Robotics an der Fachhochschule Graubünden entwickelt eine spezielle Software, die Forstleute dabei unterstützen soll, nach einem heftigen Sturm herauszufinden, wo wie viele Bäume liegen. Und wo sich Lawinenverbauungen wi...
Verband & Politik | Zeitschriften – Lesezeit 3 min
Krisenmanagement eines Försters nach gewaltiger Zerstörung im Wald
Eine verheerende Gewitterfront veränderte Ende Juli das Leben im Nordwesten der Schweiz. In wenigen Minuten zerstörten apokalyptische Winde Häuser, Bäume und Wälder. Und für Förster Hubert Jenni begann die anstrengendste Zeit seines Lebens.
Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Bogiebänder: weniger Schäden und weniger Kraftstoffverbrauch
Die Verwendung von Raupenaufsätzen auf Rädern hilft, den Bodendruck zu verringern und tiefen Fahrspuren vorzubeugen. Doch welche Traktionsband-Typen gibt es, und was sagen die Anbieter zu diesen Produkten? Das sind die wichtigsten Punkte.
Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Waldrandumbau: mehr Licht, mehr Struktur und mehr Vielfalt
Schweizer Forstbetriebe helfen tatkräftig mit, die Biodiversität im Wald zu erhöhen. Im Kanton Basel-Landschaft sollen bis 2024 rund 750 Kilometer Waldrand aufgewertet sein. Worauf es bei Umwandlung und Pflege ankommt, erklären drei Baselbieter Experten.
Zeitschriften – Lesezeit 4 min
So sorgen Bäume ausserhalb des Waldes für Umsatz
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um mit Bäumen Geld zu verdienen. Auf landwirtschaftlichen Flächen beispielsweise bieten sich Waldgärten, Agroforstsysteme oder Trüffelplantagen dafür an. Dabei gilt es aber – wie im Wald auch – auf Verschiedenes zu a...
Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Neues Merkblatt der LWF: Waldpflege im Klimawandel
Beim Stichwort «Waldumbau» aufgrund der sich verändernden klimatischen Bedingungen wird oft an Wiederbewaldung oder die reguläre Verjüngung instabiler, risikoreicher Bestände gedacht. Doch es geht auch um bereits vorhandene Bestände.
Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Kreuzresistenz gegenüber Pilz und Käfer bei Eschen
Eine neue Untersuchung an Schweizer und skandinavischen Eschen zeigt, dass Eschen, die eine erhöhte Resistenz gegen das Eschentriebsterben besitzen, besser gegen den Eschenprachtkäfer gewappnet sind. Eine gezielte Förderung könnte die Ausbreitung des Kä...
Zeitschriften – Lesezeit 2 min
Invasive Arten verursachen weltweit Milliarden-Schäden
Der Mensch bringt sie beabsichtigt oder unbeabsichtigt in ein neues Ökosystem ein, von wo aus ihr Feldzug beginnt. Gebietsfremde Tier-, Pilz- und Pflanzenarten gelten als eine der wichtigsten Treiber vom Wandel in der Natur.
Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Sturmschäden im Kanton Neuenburg – Erste Bilanz der Naturkatastrophe
Über 1000 Hektaren verwüsteter Wald, 5000 beschädigte Gebäude und eine grob geschätzte Schadenssumme von 70 bis 90 Millionen Franken: Der Jahrhundertsturm in La Chaux-de-Fonds sprengt alles Bisherige.
Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Hallimaschpilz setzt den Eschen ebenfalls stark zu
Vom Eschentriebsterben betroffene Eschen zeigen oft eine Infektion des Wurzelsystems und des Stammfusses mit Hallimasch. Die Wurzelzersetzung führt zu einem Stabilitätsverlust. Richtlinien sollen helfen, Gefahren richtig einzuschätzen und zu minimieren.
Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Renaissance von Schweizer Holzschindeln im Fassadenbau
Aufgrund ihrer natürlichen Materialien und Langlebigkeit sind Schindeln wieder sehr beliebt. 20 Prozent mehr Schweizer Holz verarbeitete die Schindelfabrik Müller in Pfäffikon (SZ). Die Nachfrage nach dem heimischen Baumaterial steigt seit einigen Jahr...
Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Wildproblem: Bund muss jetzt Lösungen aufzeigen
Weil die natürliche Waldverjüngung durch hohe Wildbestände und Verbiss bedroht ist, hat Ständerat Othmar Reichmuth (Mitte, SZ) einen Vorstoss eingereicht, der im Juni angenommen wurde. Was hat das zu bedeuten?
Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Rückblick auf Forstmesse: Spannende Tage in Luzern
An der 26. Internationalen Forstmesse Luzern vom 24. bis 27. August 2023 zeigten 220 Aussteller ihr Angebot und ihre Innovationen. WALD UND HOLZ war vor Ort und hat sich drei interessante Entwicklungen herausgepickt und näher angeschaut.
Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Forstmesse für Profis und Laien – Eröffnungsrede Daniel Fässler
Es ist höchste Zeit, dass sich die Profis aus der Schweizer Wald- und Holzwirtschaft wieder hier in Luzern treffen und sich auch mit anderen Besucherinnen und Besuchern austauschen können.
Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Im Luzerner Wald ist vieles möglich – und das soll so bleiben
Der Wald ist Erholungsort, Ökosystem und Wirtschaftszweig in einem. Diese vielfältigen Nutzungsarten führen vielerorts zu Konflikten. Auch im Kanton Luzern. Deshalb wurde eine Kommunikationskampagne für mehr gegenseitiges Verständnis lanciert.
Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Kaltluftkorridore im Staatswald gegen Hitzestau im Alterszentrum
Lassen sich Kaltluftströme aus Wäldern lenken, um Siedlungen abzukühlen? Das Stadtforst- amt der Ortsbürgergemeinde in Baden (AG) prüft in einem schweizweiten Pionierprojekt, ob der Kehlwald gezielt für erholsamen Schlaf in heissen Sommernächten sorgen k...
Zeitschriften – Lesezeit 4 min
«Bei der Planung von Holzschlägen sollten Förster uns einbeziehen»
Im Juni startete der Verband Forstunternehmer Schweiz (FUS) in eine neue Zukunft. Vizepräsident Remo Abächerli erklärt, warum Forstunternehmer immer wichtiger werden für die Waldbewirtschaftung und warum die Zusammenarbeit neu gedacht werden muss.
Zeitschriften – Lesezeit 4 min
«Die Verwendung von eigenem Holz braucht keine Ausschreibung»
In Sachen Beschaffungsrecht gibt es einen Namen, den sich Waldbesitzende merken sollten: Marc Steiner. Der Richter wirbt im Rahmen von öffentlichen Auftritten mit grosser Leidenschaft für einen Paradigmenwechsel hin zu mehr Nachhaltigkeit und Holz.
Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Eindrücke der Swedish Forestry Expo
Mit dem 12H GTE Hybrid hat Logset den Anspruch angetreten, durch Elektrounterstützung die Leistung zu steigern und den Kraftstoffverbrauch zu verringern. An der Ausstellung war der 24,5 Tonnen schwere Vollernter zu sehen.
Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Die Branche trifft sich Ende August in Luzern
Endlich ist es wieder soweit: Die 26. Ausgabe der internationalen Forstmesse steht an. Zwischen dem 24. und 27. August zeigen Ausstellerinnen und Aussteller in Luzern, was Wald und Waldprofis bewegt. WaldSchweiz wird mit zwei Ständen vertreten sein.
Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Sehr schöne Unikate dank Muskelkraft und Präzision
Mit Holz kann man heizen, Häuser konstruieren, Möbel herstellen – und Fässer bauen. Martin Thurnheer aus Berneck (SG) ist einer der letzten Küfer in der Schweiz. Er stellt in reiner Handarbeit im wahrsten Sinne des Wortes un-fass-bar schöne Unikate he...
Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Platane als Waldbaum oder von einer Alternative, die keine ist
Angesichts des Klimawandels werden Platanen immer wieder als mögliche Option für heimische Waldbäume gehandelt. Warum dieser Gedanke aufkam und weshalb das keine gute Idee ist, kann auf waldwissen.net nachgelesen werden. Das Wichtigste im Überblick.
Zeitschriften – Lesezeit 4 min
«Als Rangerinnen vermitteln wir zwischen Mensch und Wald»
Naturschutzbeauftragte sind auch zum Schutz von Wäldern unterwegs. Ein nicht zu unterschätzender Anteil unserer vielseitigen Aufgaben macht die Öffentlichkeitsarbeit in den Schutzgebieten aus. Es gibt viele, teils kritische, Fragen zu beantworten.
Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Sind Frauen die Lösung für den Fachkräftemangel im Wald?
Mitarbeiterinnen im Forst sind rar. Viele kehren ihrem Beruf nach der Gründung einer Familie den Rücken zu. Oft ungewollt. Dieser Verlust an Fachkräften könnte verhindert werden. Über Massnahmen und Strategien, um weibliche Fachkräfte im Wald zu halten.
Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Im Wald von Iraty stehen über 500 Jahre alte Buchen
Iraty, der grösste Buchenwald Europas, liegt in Spanien und Frankreich. Der Wald im Herzen der Pyrenäen beherbergt jahrhundertealte Buchen, die Wissenschaftler und Förster in Staunen versetzen. Die Bäume profitieren von einer günstigen Umgebung und Wa...
Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Das Parlament will den Ausbau der Windkraft beschleunigen
Ein entsprechender Gesetzesentwurf hat bereits die erste Hürde im Nationalrat genommen. Doch was würde die Offensive für künftige Windkraftwerke im Wald bedeuten? Eine Auslegeordnung.
Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Starkes Baumwachstum fordert eine angepasste Rottenpflege
Die Aufforstung Scharinas bei Tujetsch (GR) ist ein bedeutender Schutzwald für die Gemeinde. Die Bäume wachsen sehr schnell, und ein neues Pflegekonzept zeigt die notwendigen Eingriffe für die nächsten zehn Jahre auf: Über 100 Rotten sollen entnommen werden. ...
Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Besuch beim kleinen Alleskönner und dem schnellen Kraftprotz
Swiss Tracked Forwarder GmbH aus Herisau vertreibt mit dem Malwa 560 C Kombi und dem Forstschlepper WF Trac 2345 zwei in der Schweiz neue Maschinen. WALD UND HOLZ schaute sich die Einsatzmöglichkeiten dieser Fahrzeuge an. Und zieht ein Fazit.
Zeitschriften – Lesezeit 4 min
WF Trac 2345: die Alternative unter grossen Forstschleppern
In einem Wald in der Nähe des Zürich-Obersees ist der WF Trac 2345 im Einsatz, ein Knickgelenk-Schlepper mit 230 PS aus dem Hause Werner Forst- und Industrietechnik (WF). Der deutsche Maschinenhersteller hat seit 2022 mit Swiss Tracked Forwarder GmbH (ST...
Zeitschriften – Lesezeit 4 min
«Ein Gesetzesfossil wird heute oft überstrapaziert»
Die Bevölkerung der Schweiz hat sich verdreifacht, seit das Betretungsrecht des Waldes im Schweizerischen Zivilgesetzbuch geregelt wurde. In der Zwischenzeit hat sich nicht nur die Bevölkerungszahl, sondern auch das Freizeitverhalten hierzulande massiv v...
Zeitschriften – Lesezeit 4 min
INTERNATIONALES TREFFEN Die Lage bei uns und den Nachbarländern
Während der Bodenseeländer-Gespräche vom 27. und 28. April in Solothurn kam es zu einem Austausch unter internationalen Experten in Sachen Holzmarkt. Die wichtigsten Erkenntnisse im Überblick.
Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Holzwollematten bald mit Schweizer Buche statt Kunststoff
Die 1920 gegründete Lindner Suisse in Wattwil hielt mit ständigen Neuentwicklungen als einzige Holzwollemanufaktur der Konkurrenz des Kunststoffs stand. Ein Vlies mit Cellulose-Regenerationsfäden aus Buchenholz ist die neuste Errungenschaft.
Zeitschriften – Lesezeit 4 min
«Das ist die Waffe der Hölzigen»
Marc Steiner erklärte im Rahmen eines Vortrages, was ein Inhousegeschäft ist und wie man es bei öffentlichen Bauten nutzen kann, damit die Verwendung von Holz nicht ausgeschrieben werden muss.
Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Exodus im Wald: Es besteht dringend Handlungsbedarf
Die Schweizer Wirtschaft ächzt unter dem omnipräsenten Fachkräftemangel. Das bekommt auch die Forstbranche zu spüren. Doch was ist zu tun, um diese Entwicklung zu stoppen? Ein Bericht von Oda-Wald Schweiz nennt mehrere Punkte, die rasch angegangen werd...
Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Attraktion aus heimischem Holz in Tessiner Wäldern
Eine Art hölzerne Kugelbahn im Verzascatal kommt bei Einheimischen wie auch Touristen so gut an, dass sie nun verlängert wird. Zudem soll ein Teil davon barrierefrei werden.
Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Die Birke hat viel ungenutztes Potenzial als Konstruktionsholz
Alles begann mit einem Anruf und der Bestellung von 50 Kubikmetern Birkenbretter: AFOR-PARCO bei Locarno kombinierte sofort mit einem aktuellen Holzschlag. Was in diesem Jahr noch unter Pilotprojekt läuft, könnte bald einen Beitrag zur Deckung des land...
Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Waldbesitzer im Kreuzfeuer von unterschiedlichen Bedürfnissen
Durch die zunehmende Verdichtung der Wohngebiete steht der Wald als Erholungsgebiet zunehmend unter Druck. Nutzungskonflikte zwischen verschiedenen Interessengruppen sollen durch partizipative Ansätze und eine neu entwickelte Weiterbildung verhindert werden.
Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Rotkern: Das Nutzungspotenzial wird noch immer nicht erkannt
In Schweizer Wäldern beträgt der Buchenanteil circa 20%. Grosse, alte Buchen sind am stärksten vom Klimawandel betroffen und weisen den höchsten Anteil an Rotkern auf. Diese besondere Färbung des Buchenholzes wird noch immer zu wenig geschätzt.
Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Der Schweizer Wald – verkanntes Talent, umworbener Star
Der Wald ist mehr als nur Holzlieferant. Das ist den meisten Leuten bekannt. Die neue Waldgrafik von WaldSchweiz zeigt anschaulich die vielfältigen, oft nicht direkt sichtbaren Leistungen unseres Waldes, von denen wir als Gesellschaft tagtäglich profitie...
Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Waldleistungen, ein Geschenk der Natur und eine Aufgabe für alle
Der Bund sorgt dafür, dass der Wald seine für uns essentiellen Funktionen und Leistungen erfüllen kann. Während zu erwartenden Veränderungen eine grosse Herausforderung darstellen, kann die Sicherstellung der Waldleistungen nur durch die Zusammenarbeit aller Wal...
Zeitschriften – Lesezeit 4 min
Wenn es ums Geld geht, kommen die Wenn und Aber
WaldSchweiz hat seine strategischen Stosslinien für die Jahre 2023 bis 2026 erarbeitet. Wie dieser Prozess ablief und wo der Verband der Waldeigentümer die nächsten vier Jahre seine Schwerpunkte setzt, erläutert der Präsident, Ständerat Daniel Fässler, im...
Zeitschriften – Lesezeit 2 min
Nachgefragt bei vier Förstern – Wie beurteilen Sie die Lage beim Energieholz?
Seit vergangenem Sommer ist der Bedarf an Holz für Hackschnitzel, Pellets & Co. grösser, die Preise sind teils bis zu 15 Prozent gestiegen. Der höhere Erlös lässt Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer aufatmen.
Zeitschriften – Lesezeit 2 min
EU: Privatwaldbesitzer fordern faires Abkommen für Bioenergie
Basierend auf einem Kommissionsvorschlag hat das EU-Parlament diverse Änderungen für die Nutzung von Energieholz beschlossen. Die europäischen Waldbesitzer sind konsterniert. Ein Gegenvorschlag liegt bereits auf dem Tisch.
Zeitschriften – Lesezeit 2 min
«Wir müssen 70 bis 80 Franken pro Festmeter bekommen»
Zurzeit laufen Verhandlungen zwischen Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern sowie den Betreibern von Holzkraftwerken, die auf der Suche nach mehr Holz für die Energienutzung sind. Doch wer mehr Holz verlangt, muss auch mehr bezahlen, so die Devise von...
Zeitschriften – Lesezeit 2 min
Totems – wenn geschnitzte Pfähle Geschichten erzählen
Von der kanadischen Westküste gestohlen und weltweit verkauft, fordern heute die First Nations ihre aus Roten Zedern bearbeiteten Totems zurück. Durch die Abholzung der Küstenwälder werden diese Bäume dort jedoch immer seltener. Eine Spurensuche.
Zeitschriften – Lesezeit 2 min
Jura will grüne Energie dank Wasserstoff aus Holz
Das Unternehmen «H2 bois SA» lanciert in Glovelier sein Projekt zum Bau einer Anlage, die aus Holz grünen Wasserstoff herstellen soll. Das Verfahren frisst wenig Strom und belastet die Umwelt weit weniger als die Produktion von grauem Wasserstoff.
Zeitschriften – Lesezeit 2 min
Sind alte Mittelwälder eine neue Energiequelle für Frankreich?
Holz aus dem Wald als Wärme- und Energiequelle profitiert von den hohen Preisen von fossilen Brennstoffen. Wie eine kleine Untersuchung für «La Forêt» zeigt, könnten alte französische Nieder- und Mittelwälder den Engpass überbrücken.
Zeitschriften – Lesezeit 2 min
«Wirtschaftlich betrachtet ist der Mittelwald Nonsens»
Weil es mehr Energieholz braucht, kommt der Mittelwald als neue alte Bewirtschaftungsform ins Spiel. Die Idee: Die Unterschicht als Quelle für Energieholz, die Oberschicht für den Haus- oder Möbelbau. Doch Mittelwald ergibt nur aus ökologischer Sicht Sinn...
Zeitschriften – Lesezeit 2 min
Kommentar eines forstlichen Betriebleiters
Meinrad Lüthi, Förster und Betriebsleiter aus dem Kanton Solothurn, fordert, dass die schwerfällige Indexierung von Energieholz kurzfristig unkompliziert auf ein vertretbares Niveau angepasst wird. Seine Argumente.
Zeitschriften – Lesezeit 2 min
Mit dem «Rocket» soll das weltweit höchste Wohngebäude aus Holz entstehen
Das Bauprojekt soll in Winterthur realisiert werden. Doch für das Fundament des Wolkenkratzers ist Beton derzeit noch unersetzlich. Die Firma Timbatec sucht nach neuen Wegen, um Holz auch beim Bau von Untergeschossen einzusetzen.
Zeitschriften – Lesezeit 2 min
«Am liebsten renne ich über sanft federnden Waldboden»
Wenn die Solothurner Läuferin Martina Strähl für ihre Wettkämpfe trainiert, dann tut sie das immer wieder gerne auch in den Wäldern Richtung Schwengimatt. Dabei geniesst sie nicht nur die frische Luft, sondern sieht auch andere Vorteile im «Fitnesscenter Wald»...
Zeitschriften – Lesezeit 2 min
Bürgerliche hadern mit Holzbaustrategie
Die Grüne Fraktion im Kanton Glarus möchte bei Infrastrukturbauten wie Brücken vermehrt Holz einsetzen. Nur ein Teil der Bürgerlichen im Landrat unterstützte diese Forderung.
Zeitschriften – Lesezeit 2 min
EU beurteilt Wald vor allem nach seiner Funktion für die Umwelt
Die privaten Waldbesitzer in Europa (CEPF) sind besorgt über die Ausrichtung und Umsetzung des «European Green Deal» in Bezug auf den Forstsektor. Es besteht die Gefahr, dass ökologische Aspekte und Schutzgedanken die Oberhand über die Nutzung gewinnen.
Zeitschriften – Lesezeit 2 min
«Als der GAV scheiterte, hat es mir das Herz gebrochen»
Peter Piller war vierzehn Jahre im Vorstand, davon acht als Co-Präsident des Verbands Schweizer Forstpersonal (VSF). Anfang September ist er zurückgetreten. Die Ausarbeitung eines nationalen Gesamtarbeitsvertrags (GAV) konnte Piller trotz viel Herzblut nic...
Zeitschriften | Holzmarkt – Lesezeit 2 min
Holzmarkt im Jahr 2023
Die Holzpreise in der Schweiz befinden sich seit drei Jahren in einem Aufwärtstrend. 2021 waren sie so hoch wie zuletzt vor zehn Jahren. Nun stellt sich die Frage, wie die aktuellen Weltgeschehnisse die Situation für das Schweizer Holz im kommenden Ja...
Zeitschriften – Lesezeit 2 min
Sponsoring: Förster erschliessen neue Finanzquellen für den Wald
Die Kostenlast zwingt Forstbetriebe, neue Geldquellen für den aufwändigen Umbau des Waldes zu finden. Die Stadt Baden geht neue Wege und überzeugt Firmen, sich für zukunftsfähige Wälder zu engagieren. Das Modell hat Modellcharakter für andere Waldbesitzer.
Zeitschriften – Lesezeit 2 min
Was genau ist Waldbaden beziehungsweise Shinrin-Yoku?
Kann man im Wald baden? Das geht tatsächlich. Was es damit auf sich hat, erklärt Nadine Gäschlin, Gründerin der Waldbaden Akademie Schweiz. Und auch, welche Chancen diese Art des Waldaufenthalts Gemeinden, Waldbesitzern und dem Forstpersonal eröffnet.
Zeitschriften – Lesezeit 2 min
Doppelte Vorsicht bei Arbeiten mit Kabel-Elektrosägen
Beim Führen einer Motorsäge geht nichts über die richtige Arbeitstechnik und Konzentration, um Unfällen vorzubeugen. Wie sehr Schnittschutzhosen eine gravierende Verletzung verhindern, wurde in Deutschland getestet. Hier die wichtigsten Erkenntnisse.
Zeitschriften – Lesezeit 2 min
Von kränkelnden Weisstannen und der Frage, wie es weitergeht
Die trockenen und heissen Sommer machen nicht nur der Fichte, sondern an vielen Standorten auch der Weisstanne zu schaffen. Im Elsass werden darum nicht nur Forstfachleute, sondern auch Privatwaldbesitzer darin geschult, die Gesundheit der Bäume einzusch...
Zeitschriften – Lesezeit 2 min
Intensive Jagd bewahrt Waldflächen vor Verbiss
Wo die Zunahme des Rotwilds den Schutzwald bedroht, müssen Forst- und Jagdbehörden eingreifen. Ein Beispiel ist die Region Interlaken. Dort wird der Hirschbestand zugunsten der Verjüngung reguliert.
Zeitschriften – Lesezeit 2 min
«Hirsch und Mensch müssen sich erst noch finden»
Der Rothirsch erobert das Mittelland. «Wald und Holz» fragte den Wildbiologen und Fotografen Robin Sandfort, warum das Rotwild jetzt in dicht besiedelten Talregionen auftaucht. Und welche Auswirkungen auf den Wald im Mittelland zu erwarten sind.
Zeitschriften – Lesezeit 2 min
Gutachten bringt mehr Klarheit für Waldbesitzer bei Haftungsfragen
Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) liess untersuchen, wer eigentlich bei grossflächigen Waldschäden haftet. Eines geht daraus deutlich hervor: Die Kosten für zwingende Massnahmen können nicht nur Eigentümerinnen und Eigentümern übertragen werden.
Zeitschriften – Lesezeit 2 min
Ist Heizen mit Holz wirklich eine schädliche Steinzeittechnologie?
Wetterexperte Jörg Kachelmann setzt Heizen mit Holz mit der Verbrennung von Wald am Amazonas gleich. Die Feinstaubbelastung durch Holzöfen und Cheminées sei zeitweise höher als durch den Autoverkehr, behauptet er im «Tages-Anzeiger». Doch stimmt das...
Zeitschriften – Lesezeit 2 min
Waldbau im Klimawandel: Einfach weiter wie bisher?
In einem Beitrag in der Augustausgabe von «Wald und Holz» argumentierte eine Autorengruppe, dass sich der Wald mit dem bisherigen naturnahen Waldbau an den Klimawandel anpassen lässt. Der aktuelle Forschungsstand verlangt eine andere Schlussfolgerung.
Zeitschriften – Lesezeit 2 min
Besuch im vielleicht trockensten Wald Mitteleuropas
Seit mehreren Wochen hat es in vielen Regionen der Schweiz kaum geregnet. Laubbäume werfen wegen Wassermangel und Temperaturen von bis zu 40 Grad ihr Laub schon im Sommer ab. Und die Förster in den Bergkantonen kämpfen bereits mit erhöhtem Borkenkäferbefall.
Zeitschriften – Lesezeit 2 min
Auf der Suche nach dem Saatgut für die Bäume der Zukunft
MyGardenOfTrees testet Samen unterschiedlicher Herkünfte. Das Forschungsprojekt lädt Forstleute aus ganz Europa zur Teilnahme an diesem Gross-Experiment ein. Das Instrument hilft bei der Auswahl der optimalen Provenienzen für klimaresistente Wälder.
Zeitschriften – Lesezeit 2 min
Welcher Waldbau in der Zukunft? Der Femelschlag hat viele Vorteile
Durch die Klimaveränderungen sind die Wälder gefordert. Doch ihre Anpassungsfähigkeit lässt einen gewissen Handlungsspielraum. Wenn es um natürliche Verjüngung geht, bietet sich hier eine ganz bestimmte Betriebsform an.
Zeitschriften – Lesezeit 2 min
@jagd_fee begeistert Jugend für den Wald
Fee Brauwers (25) polarisiert in den sozialen Medien, verbindet im Privaten Gegensätzliches und will nur eines: Den Wald schützen. Deshalb isst die passionierte Jägerin nur Wildtiere, die sie selber schiesst. Für die Forstbloggerin die effizienteste...
Zeitschriften – Lesezeit 2 min
Trüffel - vom Schweinefutter zur Delikatesse aus dem Wald
Försterinnen und Förster interessieren sich immer mehr für diesen besonderen Wurzelpilz. Die Produktion allerdings bleibt marginal, auch wenn die Verkaufspreise steigen.
Zeitschriften – Lesezeit 2 min
Zwei Förster, ein besorgter Blick: Gedanken zum Baum des Jahres
Bereits zum zweiten Mal wurde die Buche mit dem Ehrentitel «Baum des Jahres» ausgezeichnet – doch wird es je ein drittes Mal geben können? Die Zukunft der Buche macht den Fachleuten zunehmend Sorgen. Wie es ohne «Mutter des Waldes» weitergehen könnte, ist...
Waldwissen | Zeitschriften | Verband & Politik – Lesezeit 5min
Newsletter 7/2022 22. August
Zeitschriften – Lesezeit 2 min
Ein eigenwilliger Bauer setzt beim Bau seines Kuhstalls ganz auf Holz
Den neuen Laufstall für seine Kühe wollte der Innerschweizer Milchbauer Willy Helfenstein komplett mit Holz aus Wäldern der Umgebung bauen. Selbst bei den Schalungstafeln für die Güllegrube aus Beton gab es für ihn keine Kompromisse.
Zeitschriften – Lesezeit 2 min
«Holz und Wald: Da werden viele positive Emotionen ausgelöst»
Simon Oberbeck, Landrat Basel-Landschaft, setzt sich vermehrt für die Anliegen von Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern ein. Woher dieses Engagement kommt, erzählt er bei einem Rundgang durch Hardwald bei Basel, wo er sich täglich Energie für den Alltag h...
Zeitschriften – Lesezeit 2 min
Bis zur Pensionierung im Wald – Berufserfahrene brauchen Anpassungen
Vor einigen Jahren hat der Verband Schweizer Forstpersonal erstmals eine Veranstaltung zum Thema «Älterwerden im Forst» durchgeführt. Dabei wurde klar, dass das Älterwerden im Forst ein Thema ist. Es lohnt sich, dieses anzusprechen und darüber nachzudenk...
Zeitschriften – Lesezeit 2 min
Dieselpreise und Mangel an Ersatzteilen verteuern Holzschlag
Im Herbst werden die Forstunternehmen höhere Regiepreise verlangen. Grund sind die Treibstoffpreise für die Ernte- und Transportmaschinen. Auch Ersatzteile und Neufahrzeuge sind teilweise schwer zu bekommen – das bleibt nicht ohne Folgen.
Zeitschriften – Lesezeit 3 min
Honorierung von Waldökosystemleistungen und Waldprodukten
Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer fordern Geld für das, was ihre Wälder für die Gesellschaft leisten, sei es im Bereich Gesundheit, Erholung, Trinkwasser- oder Luftreinigung sowie CO2-Senke. Ein Vorschlag, wie die Abgeltungs-Berechnungen aussehen könn...
Zeitschriften – Lesezeit 3 min
Mit LiDAR auf der Suche nach Rückegassen im Wald
Zum Schutz des Waldbodens und als Hilfe bei Planungsaufgaben wird im Kanton Aargau die Feinerschliessung digitalisiert. Mit Bilderkennungssoftware und künstlicher Intelligenz konnte dieser Prozess deutlich vereinfacht und beschleunigt werden – Raffael Bien...
Zeitschriften – Lesezeit
Neuheit: Elmia E Forwarder
An der internationalen Forstmesse Elmia-Wood in der Nähe von Jönköping (Schweden) zeigte der schwedische Forstmaschinen-Hersteller Malwa eine Weltneuheit: den ersten rein elektrisch betriebenen Forwarder. Die kleine kompakte Maschine soll wie seine Di...
Zeitschriften – Lesezeit 3 min
Menge an nachwachsendem Holz lässt sich nur einmal verteilen
Nach vier Jahrzehnten kontinuierlichen und überschaubaren Wachstums steigt die Nachfrage nach Energieholz und nach Wärme und Strom aus Holz plötzlich stark an. Das bringt nicht nur neue Herausforderungen mit sich, sondern macht die Versorgungssicherheit zum Thema – An...
Zeitschriften – Lesezeit
«Schweizer Wälder werden künftig wieder mehr genutzt»
Ständerat Daniel Fässler (Die Mitte) ist seit 2017 Präsident von WaldSchweiz. Zeit, ein Fazit zu ziehen. Wie hat sich der Verband seit seiner Übernahme des Präsidiums gewandelt? Und welche politischen Ziele wurden erreicht, und wo besteht noch Handlungsbed...
Zeitschriften – Lesezeit 3 min
Von einer uralten Buche und der Suche nach einem Schnelltest
Forschungsproben einer der ältesten Buchen Deutschlands haben gezeigt: Nur wenige genetische Merkmale entscheiden darüber, ob ein Baum Hitze und Trockenheit übersteht. Das wollen die Wissenschaftler nun für die Anpassung der Wälder an die Klimakrise...
Zeitschriften – Lesezeit 3 min
Gesetz verlangt Ausbildung für Holzerntearbeiten im Wald
Mit der Einführung des neuen Waldgesetzes kam eine wichtige Neuerung: «Werden Holzerntearbeiten im Auftragsverhältnis ausgeführt, so ist das Absolvieren von mindestens zehn Kurstagen obligatorisch.» Hier ein Überblick, was das genau bedeutet – Roger...
Zeitschriften – Lesezeit 3 min
Wald und Holz Faktencheck
Die Fondation Franz Weber hat in ihrem Journal Anfang Jahr eine Analyse zum Wald und zur Forstwirtschaft verfasst und dort die Waldbesitzer indirekt kritisiert. Doch stimmen die Angaben, die in diesem Text gemacht werden? «Wald und Holz» macht den Fa...
Zeitschriften – Lesezeit 3 min
Grosse Wildtierbrücken aus Holz sind problemlos möglich
Interne Berichte, die bislang unveröffentlicht blieben, zeigen: Die Wildtierquerung von Tenniken über die A2 wäre aus Holz die bessere Lösung gewesen. Doch die Behörden waren zu wenig beharrlich. Der Kanton Aargau hat vorgemacht, wie’s geht – Mischa Hausw...
Zeitschriften – Lesezeit 3 min
Grosse Ausstellung in Zürich: Die Menschheit und ihr Wald
«Im Wald. Eine Kulturgeschichte» dokumentiert den Umgang des Menschen mit seinem frühesten Lebensraum. Zahlreiche Kunstwerke zelebrieren die Schönheit und Kraft der Bäume. Wie eine nachhaltige Waldbewirtschaftung funktioniert, kommt jedoch kaum zur Sp...
Zeitschriften – Lesezeit 5 min
Burnout – Schweizer Förster leiden lieber heimlich
Auch in der Forstwirtschaft ist Burnout ein ernstzunehmendes Thema. Arbeits- und Einsatzplanung, Öffentlichkeitsarbeit, Vermitteln zwischen Waldbesitzern und Interessengruppen – forstliche Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter sind tagtäglich gefordert. W...
Zeitschriften | Holzmarkt – Lesezeit 2 min
Wie funktioniert Direktmarketing im Wald?
Kleine Säge – Grosser Nutzen! Der Forstbetrieb von Sierre/Siders in der Schweiz sägt seine eigene Bäume. Das Holz verkauft er lokal und sorgt somit für eine CO2-reduzierte Lieferkette. Zudem produziert der Forstbetrieb unter der Leitung von Julien Zuff...
Zeitschriften – Lesezeit 2 min
Skandinavisches Holz in Schweizer Bahnhöfen
Die SBB wollen den Reisenden in Bahnhöfen wie Basel und Zürich einen möglichst angenehmen Aufenthalt bieten. Doch das Material für die Modellbäume kommt nicht aus heimischen Wäldern.